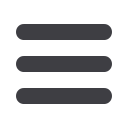
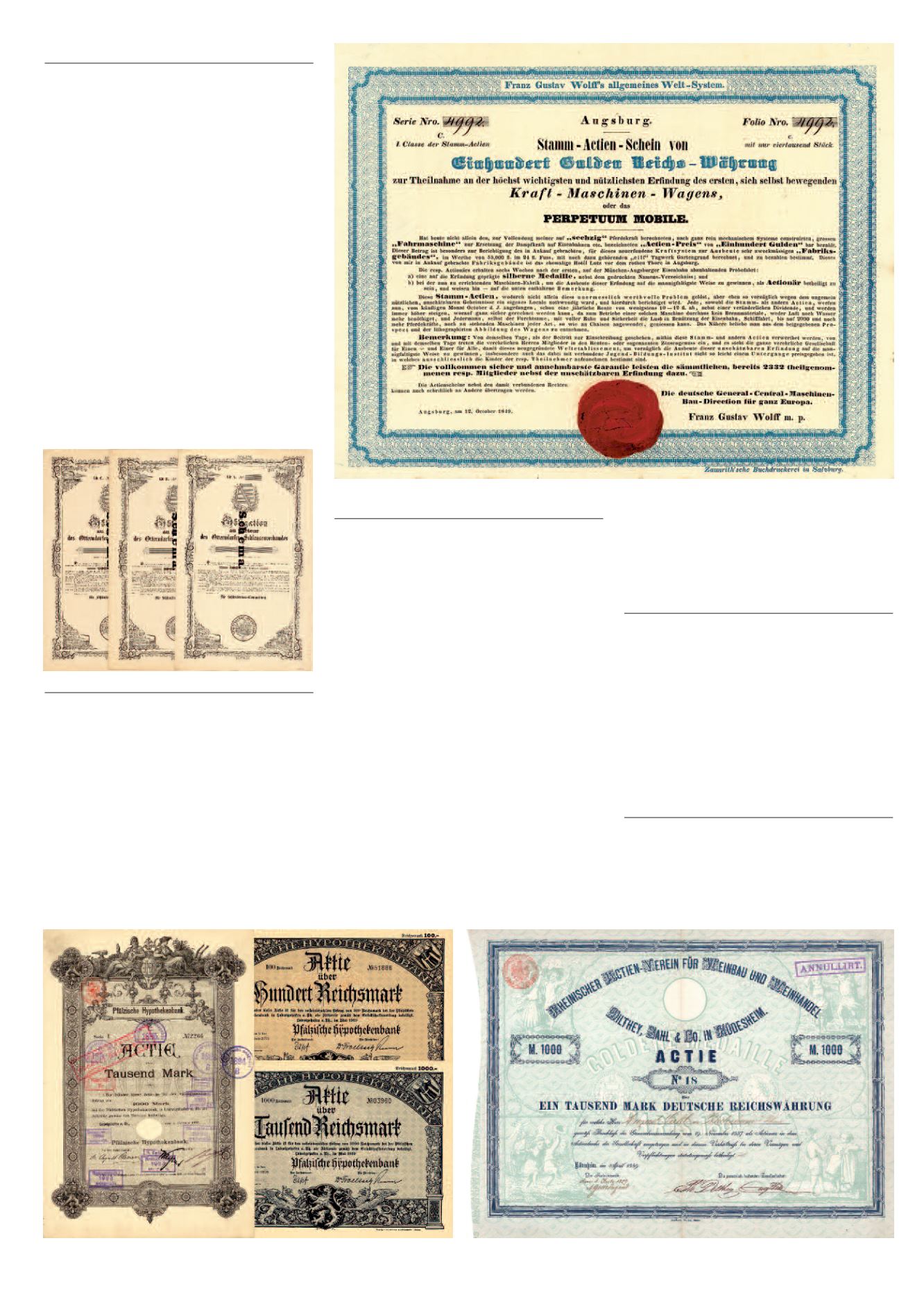
N
Los 1376
Ausruf 450 €
Otterndorfer Schleusenverband (3 Stücke)
Otterndorf, 4 % Obl. 200, 300 + 500 Thaler o.D.
(von 1863) (Muster) EF-. (32)
Nicht nur alt, auch noch sehr dekorativ mit Abb. von
Dampfschiff, Pferdefuhrwerk, Segelschiff, Eisenbahn
in allen vier Ecken sowie Otter in runder Vignette.
Überdruckt mit “Schema”. Mit Kupons. Dazu die Be-
kanntmachung der Anleihe als Beiblatt zum Ottern-
dorfer Wochenblatt und Anzeiger Nr. 29.
Die Planung der Verbindung zwischen Unterelbe und Unterweser geht auf
frühe Verträge des Jahres 1542 zwischen Sachsen-Lauenburg, Bremen
und Hadeln zurück. Ein erster Streckenabschnitt, der 1608/09 entstand,
wurde auf Veranlassung des Erzbischofs von Bremen wieder zugeschüt-
tet. Neuerliche Grabungen erfolgten 1661 und 1768 bis 1773. Nachdem
auch ein französisches Vorhaben (1806-11) nicht über das Planungsstadi-
um hinauskam, begann man endlich 1852 mit dem Bau der Otterndorfer
Schleuse und der Verbindung der Elbe mit dem Bederkesasee. Der Kanal,
der ursprünglich eine Hochwasserschutzmaßnahme darstellte, erwies
sich als verkehrstechnisch überaus nützlich, woraufhin man den Bederke-
sasee mit der Weser bei Bremerhaven durch einen weiteren 11 km langen
Kanal verband, der - über eine Schleuse bei Lintig - vom Bederkesasee
zur Geeste führt. Der Bau einer dritten Schleuse auf der Geeste bei Schiff-
dorf machte die Geeste einerseits von der Tide unabhängig, führte ande-
rerseits aber dazu, daß die Fahrwassertiefe für den Schiffsverkehr zu ge-
ring wurde und durchgehender Verkehr nach 1898 nicht mehr möglich
war. Nachdem man 1935 bis 1937 den Kanal vertieft hatte, nahm auf ihm
indes der Schiffsverkehr wieder zu und wurde durch weiter Baumaßnah-
men 1957 bis 1961 - einschließlich der Errichtung eines Tidesperrwerks
auf der Geeste bei Bremerhaven - auf der ganzen Strecke gefördert. 1968
wurde die Schleuse Otterndorf nochmals erweitert für Schiffe bis zu 57m
Länge, 5,20m Breite und 1,50m Tiefgang. Doch nach 1973 ging das Gü-
terverkehrsaufkommen ständig zurück, so daß die Baumaßnahmen und
Instandsetzungsarbeiten der letzten Jahrzehnte im wesentlichen der Was-
serwirtschaft und der Sportschifffahrt zugute gekommen sind.
Los 1377
Ausruf 250 €
Palmen-Garten-Gesellschaft
Frankfurt a.M., 3,5 % Partial-Obl. 500 Mark
1.7.1898 (Auflage 600, R 9) VF. #1021. (2)
Teil einer Anleihe von 1 Mio. Mark für Erweiterungen
des Palmengartens. Ausgesprochen dekorativ mit
Abb. des Gebäudes. Untere Ecken defekt.
Seinen Ursprung hat der Palmengarten in dem 1868 gegründeten “Ver-
ein zur Förderung des öffentlichen Verkehrs”. Als 1866 Nassau nach
dem deutschen Krieg an Preußen fiel, musste Herzog Adolf von Nassau
seine Residenz in Biebrich aufgeben. Aus seinen Gewächshäusern und
Wintergärten wurden daraufhin etwa 30.000 Pflanzen für den Palmen-
garten erworben. Eröffnet wurde der Palmengarten am 16.3.1871, das
Haupthaus aber schon 1878 durch Feuer zerstört. Es wurde ersetzt
durch das noch viel prachtvollere große Gesellschaftshaus. Danach
mehrfache Erweiterungen, u.a. durch Erwerb von Rothschildt’scher
Grundstücke. Ursprünglich war die Dauer der Gesellschaft bis 2017
festgesetzt, erst danach sollte das Gesamtvermögen der Stadtgemein-
de Frankfurt zufallen. Tatsächlich geschah das aber schon in den 30er
Jahren, nachdem die Palmengarten-Gesellschaft die hohen Betriebsko-
sten nicht mehr tragen konnte.
N
Los 1378
Ausruf 3.500 €
Perpetuum Mobile
Augsburg, “Franz Gustav Wolff’s allgemeines Welt-
System”, Stamm-Actien-Schein 100 Gulden
12.10.1849 “zur Theilnahme an der höchst wichti-
gen und nützlichen Erfindung des ersten sich selbst
bewegenden Kraft-Maschinen-Wagens, oder das
Perpetuum Mobile” (R 9) EF-VF. #4992. (68)
Blau/schwarzer Druck mit verzierter Umrahmung und
rotem Lacksiegel. Von dieser ebenso kuriosen wie
bedeutenden Rarität wurden in den 1980er Jahren in
Österreich nur 7 Stücke gefunden, eines davon be-
sitzt inzwischen sogar das Deutsche Museum in
München.
Als Produktionsstätte für diesen Wagen hatte der “Erfinder”, der aus Böh-
men stammende Porzellanmacher Franz Gustav Wolff das ehemalige Ho-
tel Lutz vor dem Rothen Tore in Augsburg vorgesehen, für dessen Ankauf
der Emissionserlös verwendet werden sollte. Wolff bezeichnete sich gar
nicht bescheiden als “die deutsche General-Central-Maschinen-Bau-Di-
rection für ganz Europa”. Er behauptete, eine “Fahrmaschine” von 60 PS
fertig konstruiert zu haben, die ganz ohne Brennmaterialien laufen sollte,
in der Leistung auf 2.000 PS zu steigern sei und die Dampfmaschine bald
völlig ersetzen würde. Schon wurde eine Probe-Fahrt auf der München-
Augsburger Eisenbahn angekündigt. “Diese Stamm-Actien”, verspricht
der Text, “werden immer höher steigen, worauf ganz sicher gerechnet
werden kann ... Das Nähere beliebe man aus dem beigegebenen Prospect
und der lithographirten Abbildung des Wagens zu entnehmen.” Der Text
der Aktie spricht unmißverständlich von “I. Classe der Stamm-Actien mit
nur viertausend Stück”, doch nicht einmal die Tatsache, daß Wolff noch
Nummern weit jenseits der 5000 unter’s Volk brachte, öffnete den vor Gier
blind gewordenen Aktienzeichnern die Augen für die Tatsache: Das Per-
petuum Mobile war nichts weiter als ein groß angelegter Schwindel. (Ähn-
lichkeiten mit jüngsten Ereignissen am Neuen Markt sind nicht beabsich-
tigt und rein zufällig - und wir können nichts dafür, das der Name Wolff
auch fünf Buchstaben und zwei F hat). Auch die gerichtliche Verfolgung
Haf.., äh, Wolffs bis in das Jahr 1860 brachte den geleimten Geldgebern
keinen roten Heller zurück. Im Gegenteil: Nachdem der ganze Betrug so
prima funktioniert hatte und die damals sehr eingeschränkten Kommuni-
kations- und Informationsmöglichkeiten potentieller Geldgeber das Risiko
denkbar gering erschienen ließen, zog Wolff einige Jahre später den glei-
chen Schwindel noch einmal in Österreich ab. Die dabei verteilte Einla-
dung zur Probefahrt im Mai 1865 bei Linz erging von niemand geringerem
als “Im Namen der allerheiligsten untheilbaren Dreieinigkeit”. Den poten-
tiellen Aktienzeichnern, waren sie nur gutgläubige Katholiken, sollte wohl
die Vorspiegelung göttlichen Beistands jeden Rest eines Zweifels neh-
men, daß das Perpetuum Mobilie funktionieren würde.
Los 1379
Ausruf 120 €
Pfälzische Hypothekenbank
Ludwigshafen
a.Rh., Actie Ser. V 1.000 Mark
1.7.1896 (Auflage 1000, R 9) VF. #4947. (25)
Äußerst dekorativ, Löwen-Vignetten in den Ecken,
Putti und Allegorien in der Umrandung. Originalunter-
schrift des Vorstands, für den Aufsichtsrat Faksimile-
Unterschrift Dr. August Clemm (1837-1910), Mitbe-
gründer der BASF und ihr langjähriger Aufsichtsrat-
vorsitzender, Präsident der Pfälzischen Eisenbahn.
Gründung 1892. Die Gründung der Bank bildete den Abschluss langjähri-
ger Bestrebungen nach Errichtung eines Bodenkredit-Institutes, das den
pfälzischen Verhältnissen besondere Rechnung tragen sollte. 1990 auf Be-
treiben des gemeinsamen Großaktionärs Dresdner Bank Verschmelzung
mit der 1868 in Meiningen gegründeten Deutschen Hypothekenbank.
N
Los 1380
Ausruf 450 €
Pfälzische Hypothekenbank (9 Stücke)
Ludwigshafen
a.Rh., Aktien von 1892 bis 1929
EF-VF. (48)
Aktien 1.000 Mark 1.2.1892, 1.5.1893, 31.3.1894,
31.3.1895, 1.1.1908, 15.10.1908, 1.11.1922, 100 RM
+ 1.000 RM Mai 1929. Hochdekorative Stücke mit
Löwen-Vignetten in den Ecken, Putti und Allegorien
in der Umrandung.
153
Los 1378
Los 1380
Los 1397
















