
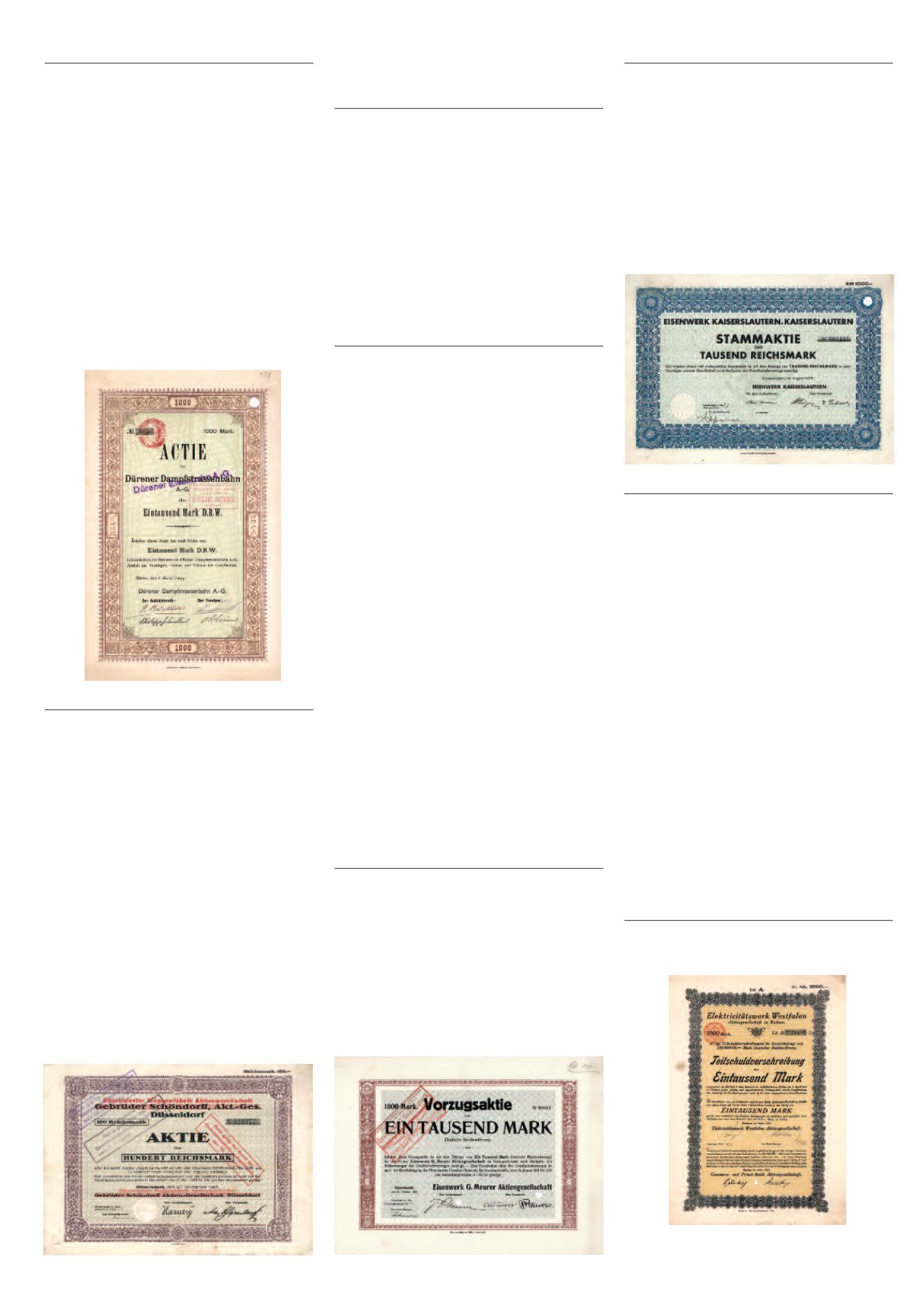
N
Los 1289
Ausruf 150 €
Dürener Dampfstrassenbahn AG
Düren, Actie 1.000 Mark 1.7.1899 (Auflage
nur 50
Stück,
R 7) EF-VF. #256. (5)
Schöne Umrahmung mit Blumenrosetten, gedruckt
auf eigenem Wasserzeichenpapier mit dem Firmen-
namen als Wasserzeichen (der Initiator der Bahn war
ja immerhin Papierfabrikant), mit vier Originalunter-
schriften für AR und Vorstand (u.a. Fr. Bücklers und
Philipp Schoeller).
Gründer der Bahn im Jahr 1892 waren 8 Privatpersonen, darunter die Pa-
pierfabrikanten Felix Heinrich Schoeller und Walter Schüll als Gründungs-
vorstände und die Fabrikanten Felix Heinrich Schoeller und Jakob Bük-
klers als Gründungsaufsichtsräte, ferner die Firmen Felix Heinrich Schoel-
ler und Zellstofffabrik Hermann Maria Schoeller und die oHG Gebrüder
Schüll. Die meterspurige Dampfstraßenbahn Düren - Birkesdorf - Merken
- Pier - Inden (11,1 km lang, abschnittweise 1893-1927 eröffnet) sollte vor
allem den Industriebetrieben im Nordwesten der Stadt Düren Gleisan-
schlüsse verschaffen (angeschlossen wurden anfangs die Gebr. Schüll
Kunstwollfabrik und die Gebr. Schoeller Teppichfabrik in Birkesdorf sowie
die Felix Heinrich Schoeller Papierfabrik in Düren, später u.a. auch die
Gaswerk Düren (1898), die Dürener Metallwerke (1899) und die Isola Wer-
ke AG (1910). Aber auch die anfänglich gar nicht vorgesehene Personen-
beförderung wurde bald aufgenommen: Immerhin hatten nicht wenige Ar-
beiter bis dahin tägliche Fußmärsche von bis zu 2 1/2 Stunden zu ihrer Ar-
beitsstelle zu bewältigen. 1913/14 Umstellung auf elektrischen Betrieb,
1939 Umfirmierung in Dürener Eisenbahn AG. 1963-65 stillgelegt, 1971
Umwandlung in eine GmbH.
N
Los 1290
Ausruf 150 €
Düsseldorfer Waggonfabrik AG
(Gebrüder Schöndorff AG)
Düsseldorf, Aktie 100 RM 20.11.1925 (Auflage
13336, nach drei Kapitalschnitten 1928, 1934 und
1935 mit Überdruck des neuen Firmennamens zu-
letzt
nur noch 60 Stück
, R 9) EF-VF. #30379. (49)
Vorkriegsaktien der Duewag waren vorher unbe-
kannt!
Gegründet 1890 von dem bedeutenden Düsseldorfer Unternehmer Albert
Schöndorff als Spezialfabrik für hölzerne Bettgestelle. 1896 Verlegung der
Fabrik in einen Neubau in der Rather Straße (1916 verkauft). 1910 Um-
wandlung in eine AG. Ab 1916 Neubau der Waggonfabrik an der Königs-
berger Straße 100. Börsennotiz Berlin, bis 1934 auch Freiverkehr Essen.
1929 Beteiligung bei der H. Fuchs Waggonfabrik AG in Heidelberg (bereits
1930 wieder abgestoßen). Während der Weltwirtschaftskrise ging die Zahl
der Beschäftigten zurück von 1600 (1929) auf 350 (1933), die Zahl der pro-
duzierten Fahrzeuge in der gleichen Zeit von 276 auf auf nur noch 85 (Ka-
pazität war für über 5.000 Waggons). 1930 übernahmen die Linke-Hof-
mann-Busch-Werke AG in Breslau die Aktienmehrheit. Kaum waren die
Nationalsozialisten an der Macht, wurde 1933 der jüdische Inhaber Albert
Schöndorff aus der Firma gedrängt, Schöndorffs Sohn Rudolf, Vize-Chef,
bekam nach der Arisierung vom „NS-Vertrauensrat“ Werksverbot. Der Se-
nior flüchtete mit Ehefrau nach Holland, wo er 1942 von der Gestapo ver-
haftet wurde. Die Deportation der Eheleute nach Auschwitz-Birkenau, wo
sie umgebracht wurden, erfolgte in Güterwagen jenes Typs, die Schön-
dorff selbst produzierte. 1933 Stilllegung der Holzbauabteilung für Innen-
einrichtungen und Umfirmierung in Düsseldorfer Waggonfabrik AG, 1935
wurde die Waggonfabrik AG Uerdingen Mehrheitsaktionär, weitere 25 %
gingen an die Waggonfabrik Talbot in Aachen. Anschließend in Düsseldorf
Konzentration auf den Bau von Nahverkehrsfahrzeugen, insbesondere
Straßenbahnen. 1959 vollständige Eingliederung in die Waggonfabrik Uer-
dingen AG, die 1981 in DUEWAG AG umfirmierte. Großaktionär war bis
1990 die Waggonfabrik Talbot, Aachen, danach der Siemens-Konzern.
1999 Übertragung des operativen Geschäfts auf die Siemens DUEWAG
Schienenfahrzeuge GmbH, 2002 vollständige Eingliederung in die Sie-
mens AG.
Los 1291
Ausruf 150 €
Duisburger Mühlenwerke AG
Duisburg, Aktie 800 RM Dez. 1942 (Auflage 1579,
weitere 1421 in einer Sammelurkunde, R 10) EF-
VF. #2833. (50)
Oben Rostfleck von Büroklammer.
Gegründet 1866 in Witten/Ruhr als KGaA A. Rosiny & Cie. 1885 Errichtung
einer neuen Mühle in Duisburg (zurückgehend auf eine 1860 von Wilhelm
Vedder am Duisburger Hafen errichtete Mühle, deren 1900 angefügter Er-
weiterungsbau heute als Küppersmühle bekannt und wunderschön wie-
der hergerichtet ist). 1897 mit Firmensitz Duisburg umbenannt in Rosiny-
Mühlen-AG. 1942 umbenannt wie oben anläßlich der Fusion mit der Wit-
tener Walzenmühle AG und der Crefelder Mühlenwerke AG. Börsennotiert
im Freiverkehr Düsseldorf, Mehrheitsaktionäre waren die Deutsche Ren-
tenbank-Kreditanstalt und die Deutsche Zentralgenossenschaftskasse.
Bis in die 1950er Jahre expandierte die Mühlen- und Getreideindustrie im
Duisburger Innenhafen, 1959 entsteht noch ein 5stöckiger Mühlen- und
Speicherkomplex (heute Sitz des Stadtarchivs und des Kultur- und Stadt-
historischen Museums). 1966 Übernahme der Dortmunder Mühlenwerke
AG. 1973 in eine GmbH umgewandelt, 1977 stillgelegt.
N
Abb. S. 132 Los 1292
Ausruf 200 €
Eduard Lingel Schuhfabrik AG
Erfurt, Aktie 1.000 Mark Jan. 1920 (Auflage 3500,
R 10), 1925 umgestellt auf 20 RM, 1933 eigentlich
durch Neudrucke ersetzt VF+. #6429. (25)
Nur 4 Stück lagen im Reichsbankschatz.
Georg Michael Eduard Lingel (* 1849 in Königsberg in Bayern, + 1922 in
Hamburg) machte eine Kaufmannslehre in einem Barmer Textilbetrieb,
lernte drei Fremdsprachen und beschloss im Alter von 23 Jahren, Unter-
nehmer zu werden. Im Haus “Zum Krummen Hecht” am Fischersand 9 in
der Erfurter Altstadt nahm Lingel 1872 mit 5 Arbeitern die Schuhproduk-
tion auf. Ganze 36 Paar Zeugstiefel schaffte er damals am Tag. Nur zwei
Jahre später stellte Lingel statt Zeugstiefeln jetzt Lederstiefel her, be-
schäftigte bald 300 Arbeiter und kaufte für den stark gewachsenen Be-
trieb das Haus Herrmannsplatz 5. 1877/78 sandte Lingel eine Delegation
in die USA, um die dortigen Fertigungsmethoden zu studieren, anschlie-
ßend stellte er seinen Betrieb von Handarbeit auf mechanische Schuhfa-
brikation um. Bald gingen große Exportaufträge aus Schweden, Holland
sowie Nord- und Südamerika ein. 1887 zerstörte ein Feuer die Fabrik, die
aber sofort mit einer Vergrößerung auf 50.000 qm Produktionsfläche in der
Landgrafenstr. 1 wieder aufgebaut wurde. Lingel war jetzt vor allem be-
kannt für rahmengenähte Herrenschuhwaren, eine Spezialität waren Dr.
Lahmanns Gesundheitsstiefel. 1898 wandelte Lingel die Firma in eine AG
um und zog sich zu Beginn des 1. Weltkrieges aus der Leitung zurück,
nachdem kriegsbedingt jede Kreativität verschwand und die Fabrik statt
dessen nur noch Militärstiefel produzierte. Nach Aufhebung der Zwangs-
wirtschaft 1919 ließ sich der Weltruf der Lingel-Schuhe wieder herstellen,
zudem konnten 1920 auch noch die lokalen Wettbewerber Mella Schuh-
fabrik und Friedrich Metzler übernommen werden. Dies begleitete Eduard
Lingel als AR-Vorsitzender noch bis zu seinem Tod 1922. Mit 2000 Mitar-
beitern produzierte die Firma jetzt 2 Mio. Paar Schuhe im Jahr und war EI-
NE DER BEDEUTENDSTEN SCHUHFABRIKEN in ganz Deutschland.
1929 Aufbau eines eigenen Vertriebs mit 46 Verkaufsstellen im ganzen
Reich. Großaktionär der in Leipzig, bis 1933 auch in Berlin und Frank-
furt/Main börsennotierten AG war inzwischen das Bankhaus Adolf Stürcke
in Erfurt. Im 2. Weltkrieg erneut Umstellung auf Kriegsproduktion, u.a.
wurden beheizbare Fliegerstiefel hergestellt. 1948 enteignet und zusam-
men mit der Schuhfabrik Hess als “VEB Schuhfabrik Thuringia” weiterge-
führt, nach weiteren Zusammenschlüssen ab 1952 der “VEB Schuhfabrik
Paul Schäfer” (Schäfer war ein früherer Lingel-Beschäftigter und KPD-Po-
litiker). Nach 1970 wurde die überalterte Bausubstanz modernisiert, nach
1980 verbesserte eine computergestützte Produktion Qualität und Ange-
bot. Beliefert wurde nun u.a. der westdeutsche Hersteller “Salamander”.
Bei der Wende umfasste der Betrieb 12 Werke mit 28 Produktionsstand-
orten. 1990 als Lingel Schuhfabrik GmbH reprivatisiert, doch eine Anpas-
sung an die veränderte Zeit mißlang. 1992 ging der Traditionsbetrieb in Li-
quidation. Die historischen Fabrikgebäude an der Arnstädter Straße wur-
den 2000 komplett und die ehemalige Fabrik an der Magdeburger Allee
2009 zum Teil abgerissen.
N
Los 1293
Ausruf 75 €
Eisenwerk G. Meurer AG
Cossebaude, VZ-Aktie 1.000 Mark 25.2.1921
(Auflage 250, R 6) EF. #24. (38)
Großformatig, schöne Umrahmung im Historismus-
Stil.
Gründung 1875 in Cossebaude bei Dresden, AG seit 1909. Herstellung
von Gaskoch-, Brat-, Back-, Bügel- und Heizapparaten, kombinierten
Gas- und Kohleherden, Tutti-Frutti-Fruchtpressen, Albeco-Feuerlöschern.
Als eine der ersten Firmen in ganz Europa hatte Meurer um 1900 mit der
Entwicklung von Gaseinzelöfen für die Raumheizung begonnen, nach
dem 2. Weltkrieg wurden dann ausschließlich Gasherde und Gasheizöfen
produziert. 1944 Fusion mit dem Mitbewerber Haller-Werke AG in Ham-
burg-Altona (gegr. 1875/76, AG seit 1895). 1949 Sitzverlegung nach Ham-
burg, wo das Werk in Altona wiederaufgebaut wurde. 1951 umfirmiert in
Haller-Meurer-Werke AG. Börsennotiert in Berlin, ab 1948 in Hamburg.
1986 in Konkurs gegangen.
N
Los 1294
Ausruf 200 €
Eisenwerk Kaiserslautern
Kaiserslautern, Aktie 1.000 RM Aug. 1929 (Auf-
lage 200,
R 11
) EF-VF. #430. (1)
Nur 2 Stück lagen im Reichsbankschatz. Dies ist das
letzte zur Verfügung stehende Stück.
Gründung 1864, zunächst Lieferung von Akzidenzguss für die Saargru-
ben. Später kam im Werk Barbarossastraße 18/48 in der Nähe des Haupt-
bahnhofs (wo noch heute der Sitz ist) dazu die Ofenfabrikation (1868), der
Brückenbau (1872) und die Fabrikation säurebeständiger emaillierter Ap-
parate (1895). Seit den 1950er Jahren mit inzwischen rd. 1400 Mitarbei-
tern außerdem Kranbau sowie Herstellung von Sanitärguß, Kompressoren
und Pumpen. Später spezialisierte sich die dann in eine GmbH umge-
wandelte EWK auf die Produktion mobiler Brücken für das Militär. 1964
kam durch Übernahme der Zschokke-Werke der Bereich Umwelttechnik
dazu. 2002 Aufspaltung des Unternehmens in die dann verkaufte EWK
Umwelttechnik GmbH und den Rüstungsbereich, den der amerikanische
Rüstungskonzern General Dynamics übernahm. Heute die “General Dy-
namics Eurepean Land Systems - Germany GmbH”.
N
Los 1295
Ausruf 200 €
Eisenwerke Gaggenau AG
Gaggenau, Aktie 1.000 Mark Juli 1922 (Auflage
8000, R 10) VF. #22470. (11)
Dekorativer Druck von G & D, mit gekreuzten Pisto-
len oben in der Umrandung. Nur 3 Stück lagen im
Reichsbankschatz, dies ist das allerletzte noch ver-
fügbare.
Bereits 1683 gründete Markgraf Ludwig Wilhelm I von Baden-Baden (bes-
ser bekannt unter seinem Ehrennamen “Türkenlouis”) eine Hammer- und
Nagelschmiede in Gaggenau, die das im Schwarzwald nur spärlich vor-
kommende Eisen zu Schmiede- und Nageleisen sowie landwirtschaftli-
chen Gerätschaften verarbeitete. Im 19. Jh. spezialisierte sich das Unter-
nehmen auf emaillierte Werbeschilder und besaß hier fast eine Monopol-
stellung. 1874 übernahm der aus Frankfurt stammende Sozialreformer Mi-
chael Flürschein das Unternehmen. Zu der Zeit wurden Fahrräder, Bade-
nia-Freilaufnaben, Gas- und Kohleherde sowie Holzbearbeitungsmaschi-
nen aller Art produziert. Als Teilhaber nahm Flürschein 1879 Theodor
Bergmann mit in’s Unternehmen, der ein Patent auf eine Luftdruckpistole
besaß; fortan auch Fertigung von Luftpistolen, die im übrigen Vorbild für
das Logo der Gesellschaft wurden, die gekreuzten Pistolen. Die Pistolen-
fertigung wurde 1889 an Jakob Mayer in Rastatt abgegeben, heute als
“DIANA Mayer & Grammelspacher GmbH” firmierend. Mit Ausscheiden
des Inhabers Flürschein wurde das Unternehmen 1888 in eine AG umge-
wandelt, größter Aktionär wurde Flürscheins vorheriger Kompagnon The-
odor Bergmann. Er gründete 1894 zusätzlich die “Bergmanns Industrie-
werke”, behielt aber auch die Leitung der Eisenwerke Gaggenau AG. Mit
dem “Orient-Express” und dem “Liliput” bauten Bergmanns Industriewer-
ke 1895 die allerersten deutschen Serienautomobile. Dazu kam die Ferti-
gung von LKW (ab 1898) und von Omnibussen (ab 1905). 1905 Ausglie-
derung der Automobilfertigung in die “Süddeutsche Automobilfabrik
GmbH”, die nach finanziellen Problemen 1912 von Benz & Cie. übernom-
men wurden, die als “Benz-Gaggenau” hier die LKW-Fertigung konzen-
trierten. Die Eisenwerke Gaggenau AG erlangten zu Beginn des 20. Jh. ei-
ne starke Stellung bei der Fertigung von Haushaltsgeräten (bekannt wa-
ren vor allem die Kohlenherde mit emaillierten Außenwänden, die bis in die
1970er Jahre gefertigt wurden). 1995 Umwandlung in eine GmbH, heute
Teil der Gruppe Bosch-Siemens Hausgeräte. (Dank an Prof. Dr. Eckhardt
Wanner für die gelungene Recherche.)
N
Los 1296
Ausruf 150 €
Elektricitätswerk Westfalen AG
Bochum, 5 % Teilschuldv. Lit. A 1.000 Mark März
1922 (Auflage 50000, R 9) EF-VF. #18490. (38)
Teil einer von der Commerz- und Privat-Bank AG ver-
mittelten Anleihe von 200 Mio. Mark. Großformatiges
135
















