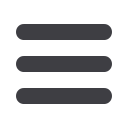
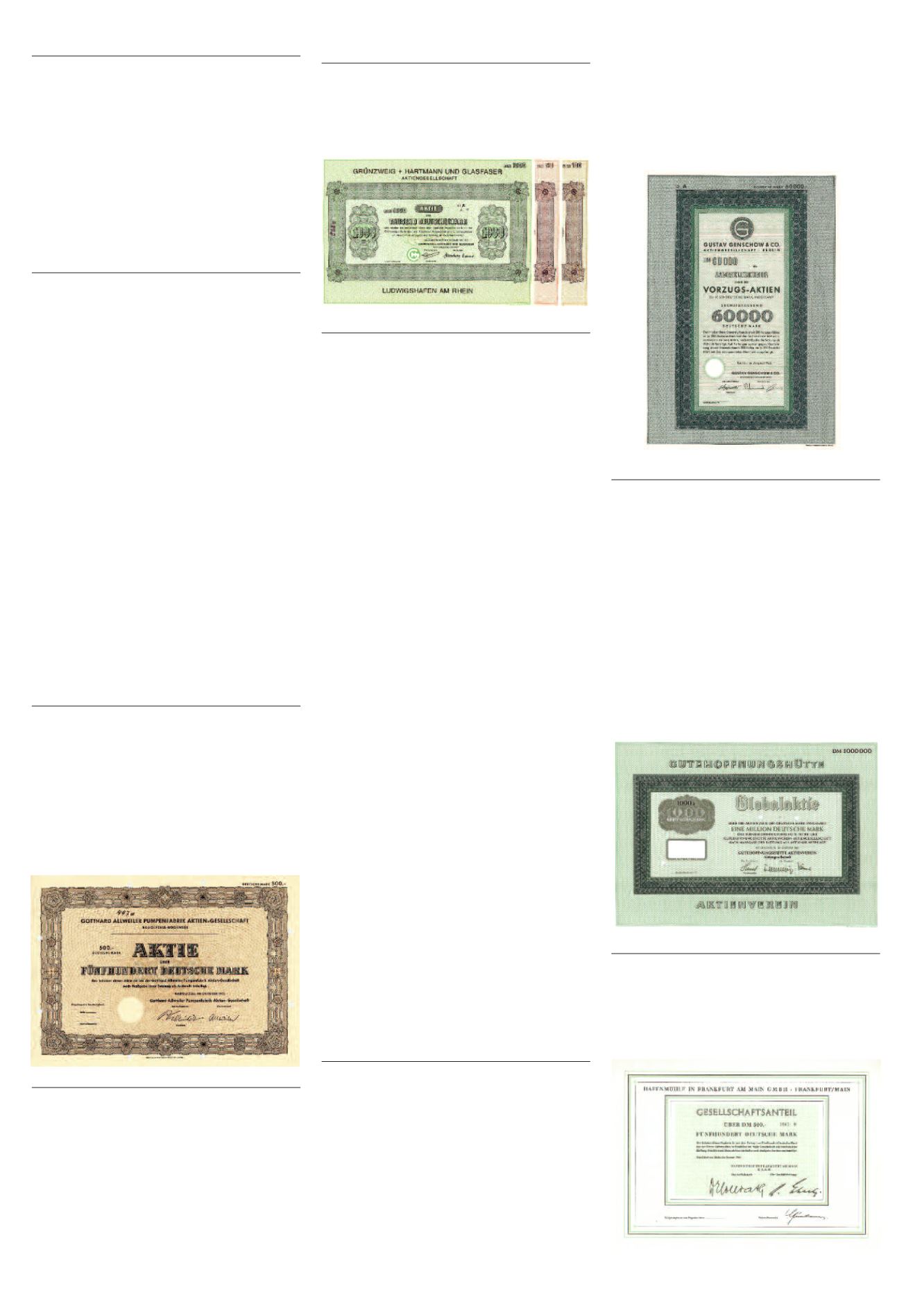
Los 1858
Ausruf 150 €
Gewerkschaft ver. Constantin der Große
Bochum, Kux-Schein 1 Kux 16.11.1953 (Auflage
5000, R 10, ausgeben in der Wertpapierbereini-
gung) EF-VF. #2. (13)
Abheftlochung.
Ursprung ist die 1849 in Bochum unter Führung von Adolf Hagedorn ge-
gründete altrechtliche Gewerkschaft ver. Constantin der Große. Lehnsträ-
ger für die ersten Mutungen Bochum, Appolonia und Joachim wurde Hüt-
tendirektor Johann Dinnendahl. Nachdem das Steinkohlengebirge 1852
erreicht wurde, ging das Bergwerk 1857 in Förderung. Günstige Verhält-
nisse machten die Zeche zu einer der rentabelsten im ganzen Revier. 1927
erlangte die Fried. Krupp AG die Kuxenmehrheit. Eine bedeutende Ver-
größerung erfolgte 1939 mit dem Erwerb der Zeche Mont-Cenis von der
Harpener Bergbau-AG. Aktionäre der 1954 im Zuge der Entflechtung ge-
gründeten AG waren nach Abgabe der Mehrheit durch Krupp zu 51 % der
Bochumer Verein für Gußstahlfabrikation und zu 26 % die Hütten- und
Bergwerke Rheinhausen AG (Krupp).
Los 1859
Ausruf 70 €
Gewerkschaft Wintershall
Celle, Kux-Schein Juli 1953 (Auflage 4000, R 8)
UNC-EF. #1743. (54)
Prägesiegel lochentwertet.
Das Kalibergwerk der 1899 in Heringen a. d. Werra im Kreis Hersfeld (wo
heute der Sitz des Deutschen Kali-Museums ist) gegründeten Gewerk-
schaft ging 1903 in Förderung. Innerhalb von zwei Jahrzehnten entstand
ein bedeutender Kali-Konzern mit 28 Kali- und 2 Braunkohlenbergwerken
vor allem in Thüringen und Hessen. Zur wichtigsten Konzerngesellschaft
entwickelte sich dabei die (1921 in Berlin/Kassel als Kali-Industrie AG ge-
gründete und 1929 umfirmierte) Wintershall AG, die mehrheitlich der Ge-
werkschaft Wintershall gehörte. Sie war anfänglich eine Holding für Betei-
ligungen an nicht weniger als 59 Kali-Gesellschaften, die aufgrund günsti-
ger steuerlicher Regelungen 1926 auf die Kali-Industrie AG verschmolzen
wurden, danach mit inzwischen 92 Kaliwerken das größte Unternehmen
seiner Art in Europa. Seine damalige Bedeutung erkennt man daran, daß
das Kapital nach der Inflations-Umstellung mit 320 Mio. RM mehr als dop-
pelt so hoch war wie das der Deutschen Bank (150 Mio)! 1931 gemeinsam
mit der Anton Raky Tiefbohrungen AG in Salzgitter Bildung des Raky-Win-
tershall-Konsortiums für die Erschließung von Erdöl- und Erdgasvorkom-
men im Kreis Celle, die Verarbeitung des Rohöls erfolgte in der (noch heu-
te bestehenden) Erdölraffinerie Salzbergen GmbH. Damit war auch der
Grundstein für das Erdgas-Geschäft gelegt, in dem die heutige BASF-
Tochter nun einer der großen europäischen Spieler ist. Die Kaliwerke erlit-
ten im Krieg keinerlei Zerstörungen (!), kamen aber Anfang April 1945 beim
Einmarsch der alliierten Truppen zum Erliegen. Die Werke Heiligenroda,
Kaiseroda, Sachsen-Weimar, Glückauf-Sondershausen, Bismarckhall und
Bernburg wurden dann der deutsch-russischen AG für Kali-Düngemittel,
Erfurt, zugeschlagen; später wurden die Betriebe von den Ländern Thü-
ringen bzw. Sachsen-Anhalt enteignet. Wintershall blieb nur die Werks-
gruppe Bergmannssegen/Hugo in Lehrte bei Hannover, die daraufhin
stark ausgebaut wurde. 1955 wurde im Wege einer feindlichen Übernah-
me die Aktienmehrheit der Burbach-Kaliwerke AG, Wolfenbüttel (früher
Magdeburg) erworben. Im gleichen Jahr ging eine gemeinsam mit der Ge-
werkschaft Elwerath (Shell) erbaute Raffinerie bei Lingen in Betrieb, nach-
dem Wintershall auch große Erdöl- und Erdgasfelder um Bremen und im
Emsland ausbeutete. 1970 Ausgliederung des Kali- und Steinsalzbereichs
in die Kali + Salz GmbH, Erwerb eines Anteils an einem Erdölfeld vor der
Küste von Dubai. 1974 vollständig in die BASF AG eingegliedert.
N
Los 1860
Ausruf 100 €
Gotthard Allweiler Pumpenfabrik AG
Radolfzell-Bodensee, Aktie 500 DM Okt. 1951
(Muster, R 10) EF-VF. (14)
Belegstück der Frankfurter Börse handschriftlich nu-
meriert (#497a). Rückseitig Klebereste. Schnittent-
wertet und gelocht.
Gründung 1860 durch Gotthard Allweiler, dem Erfinder der Flügelpumpe,
1910 Umwandlung in eine AG. Ihren Erfolg verdankte die Firma vor allem
seiner selbst entwickelten und dann über die ganze Welt verbreiteten
zwei- und vierfach wirkenden Flügelpumpe. Später auch Herstellung von
automatischen Viehtränkebecken und Kraftfahrzeugteilen. Im Freiverkehr
Frankfurt notiert, Großaktionäre waren die Familien Allweiler und Wolf.
1998 Eingliederung in die Colfax Pump Group (CPG), 2003 squeeze-out
der Kleinaktionäre.
Los 1861
Ausruf 60 €
Grünzweig + Hartmann und Glasfaser AG
Ludwigshafen
a.Rh., Aktie Lit. B 100 DM Juli 1981
(Auflage 7.500, R 9) UNC-EF. #15110. (13)
Lochentwertet.
Gründung 1878, GmbH ab 1900, Umwandlung in eine AG 1952. Entwik-
klung und Ausführung von Isoliermontagen für den Wärme-, Kälte-,
Schall- und Brandschutz sowie Herstellung von Isolierstoffen. Werke be-
standen in Bergisch Gladbach, Bochum, Ladenburg, Ludwigshafen und
Speyer. 1972 Fusion mit der Glasfaser GmbH in Aachen, die auf die 1931
zur Herstellung von Isolationsglasfasern gegründe Glaswatte GmbH zu-
rückgeht. Auf dem Gebiet Mineralfaserdämmstoffe ist das Unternehmen
bis heute Marktführer. In den 1960er Jahren wurde der französische Glas-
konzern Saint-Gobain Großaktionär und kaufte nach und nach sämtliche
Aktien auf. Heute die Saint-Gobain Isover G+H AG.
N
Los 1862
Ausruf 150 €
Grünzweig + Hartmann und Glasfaser AG
(3 Stücke)
Ludwigshafen
a.Rh., Aktie 50 DM, 100 DM +
1.000 DM Sept. 1973 (Muster, R 9) EF-VF. (14)
Belegstücke der Frankfurter Börse handschriftlich
numeriert (#568a,c,e). Rückseitig Klebereste.
N
Abb. S. 195 Los 1863
Ausruf 300 €
GRUNDIG AG
Fürth/Bay., Sammelaktie 20 x 50 DM Juli 1998
(Teilblankette, nummeriert aber ohne Unterschrif-
ten und Datum, R 10) UNC-EF. #B 000009. (13)
Dekorativ, mit Grundig-Firmensignet und großem
Porträt von Max Grundig in Form eines Fernsehbil-
des. Lediglich 10 Probedrucke wurden anläßlich der
1998er Kapitalerhöhung noch angefertigt, zu einem
vollständigen Ausdruck kam es wegen der kurz dar-
auf erfolgten Umstellung auf Stückaktien nicht mehr.
Nur 4 Exemplare blieben erhalten.
1930 wurde in Fürth die Firma “Radio-Vertrieb Fürth Grundig & Wurzer” (RVF)
gegründet. Im 2. Weltkrieg produzierte die Firma Transformatoren, elektrische
Zünder und Steuerungsgeräte (u.a. auch für die V1-Marschflugkörper und die
V2-Rakete). Nach dem 2. Weltkrieg stieg Max Grundig (geb. 1908 in Nürn-
berg, gest. 1989 in Baden-Baden) in einer ehemaligen Blechspielwarenfabrik
in Fürth in der Jakobinenstr. 24 mit einem genialen Trick in die Produktion von
Rundfunkgeräten ein: Zwar war der Bau von Rundfunkgeräten genehmi-
gungspflichtig und der Verkauf streng bewirtschaftet. Aber das umging Grun-
dig, indem er seinen Rundfunkempfänger “Heinzelmann” als auch für Laien
kinderleicht zu montierenden Bausatz lieferte und mit diesem offiziell als tech-
nischer Baukasten deklarierten “Spielzeug” die Genehmigungs- und Bezugs-
scheinpflicht umschiffte. 1948 erfolgte die Gründung der “RVF Elektrotechni-
sche Fabrik GmbH”, die nach der Währungsreform 1949 in “GRUNDIG Ra-
dio-Werke GmbH” umbenannt wurde. Die Verbundenheit zur Stadt Fürth wur-
de durch die Aufnahme des Fürther Wappens mit dem Kleeblatt in das Grun-
dig-Firmenlogo unterstrichen. Schon 1947 war mit dem Bau einer neuen Fa-
brik in der Fürther Kurgartenstraße begonnen worden. Ende 1949 hatte Grun-
dig bereits 1.000 Mitarbeiter und 150.000 Radios produziert. Der Werkssen-
der im Direktionsgebäude (heute Rundfunkmuseum Fürth) sendete im Herbst
1951 das erste regelmäßige deutsche Fernsehprogramm der Nachkriegszeit,
und im gleichen Jahr begann auch die Produktion von Fernsehgeräten. 1952
war Grundig bereits der größte Rundfunkgerätehersteller in ganz Europa und
wuchs rasant weiter. Konkurrenten wurden in rascher Folge aufgekauft, dar-
unter auch die Adlerwerke und Triumph. Diese fusionierten 1956 zur Triumph-
Adler AG und produzierten fortan nur noch Büromaschinen (Grundig verkauf-
te TA, zu der Zeit der fünftgrößte Büromaschinenhersteller der Welt, 1968 an
den US-Konzern Litton Industries). Mit einem Werk für Tonbandgeräte in Bel-
fast (Nordirland) entstand 1960 das erste ausländische Werk, dem 1965 eine
Fabrik für Autoradios in Braga (Portugal) folgte. Auch die Werksanlagen auf
der Fürther Hardhöhe und in Nürnberg-Langwasser wurden ständig vergrö-
ßert. 1972 erfolgte die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft. Anfang der
1980er Jahre war der Höhenflug vorbei: Aufkommende Konkurrenz aus Fer-
nost führte zu Umsatzeinbrüchen. Mit anfangs 24,5 % wurde der niederlän-
dische Konkurrent Philips als Aktionär in’s Haus geholt. Philips stockte 1984
auf 31,6 % auf und übernahm die unternehmerische Führung. Der Firmen-
gründer Max Grundig schied aus der Unternehmensleitung aus. Die Zahl der
Beschäftigten, die auf dem Höhepunkt in 20 inländischen und 5 ausländi-
schen Werken bei fast 40.000 gelegen hatte, schrumpfte bis 1985 auf unter
20.000. Doch auch Philips bekam die Probleme nicht in den Griff und gab
Grundig unter tatkräftiger Mitwirkung der um die Arbeitsplätze besorgten
Bayerischen Staatsregierung 1988 an ein bayerisches Konsortium unter Füh-
rung des Elektronik-Unternehmers Anton Kathrein ab. Doch die Probleme
blieben, Werksschließungen und Abbau von Arbeitsplätzen waren weiter an
der Tagesordnung. Bis 2001 war die Beschäftigtenzahl auf unter 6.000 abge-
sunken. In Jahr darauf erschreckte ein neuer Umsatzeinbruch auf 1,3 Mrd.
Euro und ein Verlust von 150 Mio. Euro die Banken so sehr, daß sie auslau-
fende Kreditlinien nicht mehr verlängerten. Im April 2003 markierte der Insol-
venzantrag das Ende eines der stärksten Symbole des deutschen Wirt-
schaftswunders der Nachkriegszeit. Die Autoradio-Sparte ging an den Auto-
mobilzulieferer Delphi Corporation, die Bürogeräte-Sparte übernahm die
Grundig Business Systems. Der wichtigste Bereich “Home Intermedia Sy-
stem”, also die Fernsehgeräteprodution, ging an den türkischen Elektroni-
khersteller “Beko Elektronik” in Istanbul. Dessen Konzept, die Marke “Grun-
dig” mit Entwicklung in Deutschland (“designed and developed in Germany”)
und Fertigung in der Türkei wieder stark zu machen, funktionierte am Ende
auch nicht: Ende 2008 wurde die in Nürnberg verbliebene Entwicklungsab-
teilung schließlich auch dichtgemacht.
N
Los 1864
Ausruf 200 €
Gustav Genschow & Co. AG
Berlin, Sammel-VZ-Aktie Lit. A 300 x 200 DM Aug.
1956 (Muster, R 10) EF+. (13)
Kupons 1-10.
1887 in Berlin Gründung einer Waffengroßhandlung mit Ex- und Importge-
schäft durch den aus Stralsund stammenden Gustav Genschow. Er erwarb
dazu 1899 die Badische Schrot- und Gewehrpropfenfabrik Durlach und
1903 die Durlacher Zündhütchen- und Patronenfabrik GmbH. Die drei Fir-
men wurden 1907 in dieser neu gegründeten AG zusammengefaßt. Auf
dem Gebiet der Jagd- und Sportmunition wurde Genschow nach Über-
nahme des Munitionsgeschäftes von Köln-Rottweil der größte Konkurrent
der Rheinisch-Westfälische Sprengstoff AG in Köln (Gruppe Dynamit-No-
bel / I.G.Farben). Einen sonst unausweichlichen Kampf vermied man durch
Abschluß eines I.G.-Vertrages 1927, der 1931 auf die Dynamit-AG vorm. A.
Nobel & Co. in Hamburg überging. Ab 1938 konnten die in Berlin und Ham-
burg börsennotierten Genschow-Aktien 5:2 in I.G.-Farben-Aktien umge-
tauscht werden. Das gesamte Vermögen wurde wegen Zugehörigkeit zum
I.G.-Farben-Konzern durch alliiertes Kontrollratsgesetz Nr. 9 vom
30.11.1945 beschlagnahmt. 1951 kamen die Munitions- und Schrotfabrik
Karlsruhe-Durlach und die Lederwarenfabrik Altstadt-Hachenburg wieder
in Gang, 1953 Entlassung aus der alliierten Kontrolle und Auflösung des
I.G.-Vertrages mit der Dynamit-AG vorm. Alfred Nobel & Co. in Troisdorf,
die aber mit zuletzt 94 % Hauptaktionär blieb. 1960 Umwandlung in eine
GmbH, 1963 gingen die Genschow-Werksanlagen auf die Dynamit Nobel
AG über. 1966/67 Zusammenführung der Marken GECO, Rottweil und
RWS, 1972 Verlegung der Firma von Karlsruhe-Durlach nach Fürth/Sta-
deln. 2002 Übernahme durch den Schweizer Technologiekonzern RUAG
und Weiterführung als RUAG Ammotec GmbH. An deren Standorten Fürth
und Sirok (Ungarn) wird GECO-Munition bis heute hergestellt.
N
Los 1865
Ausruf 200 €
Gutehoffnungshütte Aktienverein AG
Oberhausen, Aktie 1.000 x 1.000 DM Jan. 1982
(Muster, R 10) EF. (13)
Gründung 1808/10 als Gewerkschaft, ab 1872 AG. Die Gesellschaft gilt als
Keimzelle der Schwerindustrie des Ruhrgebietes. Drei 1808/10 in der “Hüt-
tengewerkschaft und Handlung Jacobi, Haniel & Huyssen” in Sterkrade zu-
sammengefasste Hütten waren der Ursprung: die 1758 zu Osterfeld vom
Münsteraner Domkapitular Freiherr von der Wenge zu Dieck errichtete St.
Antony-Hütte zu Osterfeld, 1793 in den Besitz der Fürstäbtissin Maria Kuni-
gunde von Essen übergegangen, 1799/1805 an den Hütteninspektor Gottlob
Jacobi und seine Schwager Franz und Gerhard Haniel aus Ruhrort verkauft;
weiterhin die Hütte Gute Hoffnung in Sterkrade, zu deren Bau Friedrich der
Große 1781 die Erlaubnis erteilt hatte, die aber wegen des Emporkommens
der Anthony-Hütte zahlungsunfähig wurde, in der Zwangsversteigerung von
der Mutter Friedrich Krupps erworben und 1808 an Heinrich Huyssen aus
Essen und dessen Schwager Gottlob Jacobi und Gerhard und Franz Haniel
weiterverkauft wurde; schließlich die im Auftrag der Fürstäbtissin von Essen
1791 durch Gottlob Julius Jacobi errichtete Eisenhütte Neu-Essen im Em-
schertal bei Schloss Oberhausen, 1805 ebenfalls an den Jacobi-Haniel-Clan
verkauft. Durch ununterbrochene Firmenaufkäufe wuchs nach Gründung der
AG ein riesiges Gebilde aus Bergwerken, Hütten- und Walzwerken und wei-
terverarbeitenden Betrieben. Heute als MAN/GHH einer der bedeutendsten
Maschinen- und Anlagenbau-Konzerne.
N
Los 1866
Ausruf 50 €
Hafenmühle in Frankfurt am Main GmbH
Frankfurt a.M., Gesellschaftsanteil 500 DM Jan.
1964 (R 8) UNC. #2048. (62)
Gründung 1868 in Hausen als Mehl- und Brotfabrik der Firma May & Co.,
seit 1881 AG. 1908 Verkauf des Grundstückes in Hausen an die Stadt
Frankfurt, 1911 Betriebseröffnung der neuen Mühle im Frankfurter Hafen
(Franziusstr. 18-20) und aus diesem Anlass Umfirmierung in “Hafenmüh-
le”. Großaktionär war ein Konsortium um das Bankhaus Alwin Steffan.
Börsennotiz Frankfurt. 1964 in eine GmbH umgewandelt. Zusammen mit
198
















