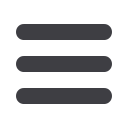
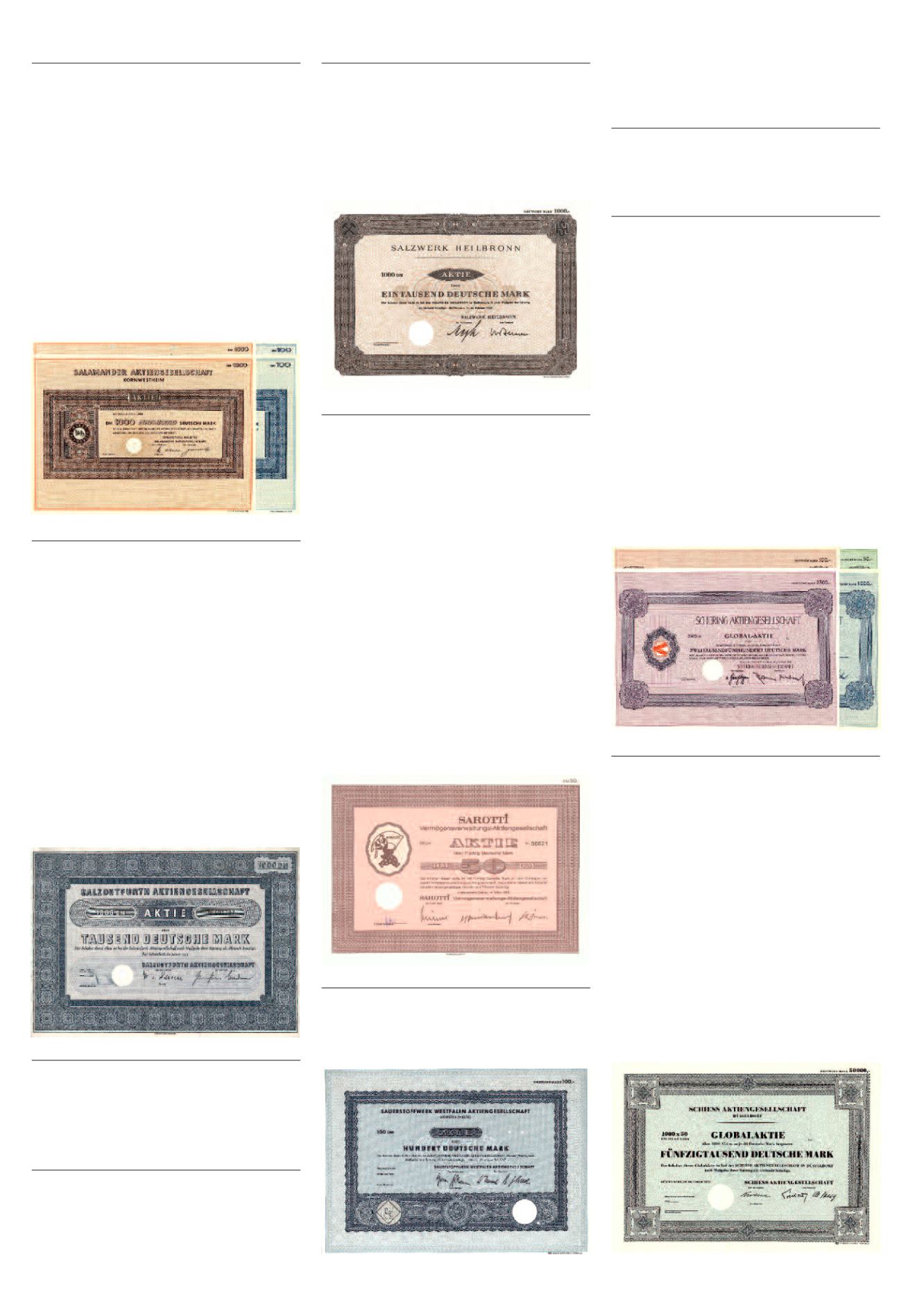
N
Los 2079
Ausruf 100 €
Salamander AG (4 Stücke)
Kornwestheim, Aktien 100 DM + 1.000 DM Juli
1960; 100 DM + 1.000 DM Juli 1967 (alles Muster,
R 10) UNC-EF. (13)
G&D-Druck, kleine Vignette mit dem bekannten “Lurchi”.
Gründung 1891, AG seit 1916 als “J. Sigle & Cie. Schuhfabriken AG”. Um
1900 gewann die Firma eine Ausschreibung zur Lieferung von Herren-
schuhen für den Berliner Schuhhändler Rudolf Moos (ein Verwandter von
Albert Einstein), der sich 1899/1904 das noch heute bekannte Markenzei-
chen eines Salamanders (den „Lurchi“) patentrechtlich hatte schützen las-
sen. 1905 gründeten Rudolf Moos und die Fa. J. Sigle & Cie. die Sala-
mander Schuhverkaufsgesellschaft mbH, die nicht nur in Deutschland,
sondern ab 1908 auch im Ausland die bis heute bekannten Salamander-
Schuhgeschäfte betrieb. In den 1980er Jahren Entwicklung zum Misch-
konzern mit den neuen Sparten Immobilien, Industrieinstandhaltungen mit
dem Dienstleister DIS und Dienstleistungen u.a. mit dem Gebäudereiniger
Gegenbauer-Bosse und dem Parkraumbewirtschafter APCOA. Nach meh-
reren Großaktionärswechseln wurde die bis dahin börsennotierte AG 1999
schließlich vollständig von der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) ü-
bernommen. 2003 Verkauf der Schuhsparte an die Garant Schuh + Mode
AG, die sich mit dieser Übernahme aber verhob und 2004 gemeinsam mit
Salamander in Insolvenz ging. 2005 Übernahme der Salamander-Schuh-
gruppe durch die Offenbacher Lederfirma EganaGoldpfeil, der dies eben-
falls nicht bekam: Nach der EganaGoldpfeil-Insolvenz ging das Salaman-
der-Schuhgeschäft schließlich 2009 an die ara Shoes AG, Langenfeld.
N
Los 2080
Ausruf 100 €
Salzdetfurth AG
Bad Salzdetfurth, Aktie 1.000 DM Jan. 1953 (Auf-
lage 44000, R 9) EF+. #16810. (13)
DM-Aktien der Salzdetfurth AG sind Raritäten, da der
komplette Bestand - bis auf eine Handvoll Beleg-
stücke - im Jahr 1980 vernichtet wurde.
Gründung 1889 als “AG für Bergbau und Tiefbohrungen” zu Goslar/Harz.
1899 Umfirmierung in Kaliwerke Salzdetfurth AG. 1937 wesentliche Um-
strukturierung durch Beseitigung der verschachtelten Konzernstruktur, da-
bei Verschmelzung mit den Überkreuzbeteiligungen Kaliwerke Aschersle-
ben und Consolidierte Alkaliwerke Westeregeln zur Salzdetfurth AG. Bör-
sennotiert in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Leipzig
und Wien. Großaktionäre waren Deutsche Bank, Commerzbank, Dresdner
Bank, Delbrück Schickler & Co., die ADCA und die Deutsche Solvay-Wer-
ke in Bernburg (Saale). Ebenfalls 1937 wurde mit dem Aufbau einer Betei-
ligung an der Mansfeld AG begonnen, die 1940 dann 98 % erreichte. Die
Freude währte nur kurz: Nach Ende des 2. Weltkrieges verloren gegangen
wie der gesamte restliche Besitz in der Ostzone. Danach neben dem eige-
nen Kalibergwerk in Salzdetfurth wesentliche Beteiligungen an den Ge-
werkschaften Lichtenberg (Kreis Wolfenbüttel, heute Ortsteil von Salzgit-
ter), Süllberg (in der braunschweigischen Gemarkung Oestrum) und Braun-
schweig-Lüneburg (Grasleben, Kreis Helmstedt, noch heute als K+S-Werk
in Förderung). 1972 Übernahme der Steinsalz-Aktivitäten der Wintershall
AG und Umfirmierung in Kali + Salz AG. Das noch heute in Kassel ansäs-
sige Unternehmen gehörte jahrzehntelang zum Konzern der BASF, die a-
ber ihre Beteiligung gegen Ende der 1990er Jahre abschmolz. Das tat der
erfolgreichen Entwicklung von K + S aber keinen Abbruch, im Gegenteil:
2008 in den elitären Kreis der DAX-Unternehmen gekommen!
Los 2081
Ausruf 75 €
Salzdetfurth AG
Bad Salzdetfurth, Aktie 1.000 DM Mai 1957 (Mu-
ster, R 10) EF-VF. (14)
Belegstücke der Frankfurter Börse handschriftlich
numeriert (#38e). Rückseitig Klebereste. Mehrfach
gelocht.
Los 2082
Ausruf 100 €
Salzdetfurth AG
Bad Selzdetfurth, Aktie 1.000 DM Juli 1961 (Auf-
lage 22500, R 9) EF-VF. #99410. (13)
DM-Aktien der Salzdetfurth AG sind Raritäten, da der
komplette Bestand - bis auf eine Handvoll Beleg-
stücke - im Jahr 1980 vernichtet wurde.
N
Los 2083
Ausruf 75 €
Salzwerk Heilbronn
Heilbronn a.N., Aktie 1.000 DM Febr. 1958 (Mu-
ster, R 10) EF-VF. (14)
Belegstück der Frankfurter Börse handschriftlich nu-
meriert (#63a). Rückseitig Klebereste. Mit Kupons.
Gründung 1888 zwecks Übernahme eines Steinsalzbergwerks nebst Sali-
ne von der Stadt Heilbronn. Noch heute als Südwestdeutsche Salzwerke
AG börsennotierte Gesellschaft, Mehrheitsaktionäre sind mit jeweils 45%
die Stadt Heilbronn und das Land. Das Salzwerk gehört zu den größten
Deutschlands und hat noch einen Salzvorrat für die nächsten zwei bis drei
Generationen.
N
Los 2084
Ausruf 90 €
Sarotti Vermögensverwaltungs-AG
Hattersheim (Main), Aktie 50 DM März 1976 (Auf-
lage 59480, es wurde aber nur noch eine niedrig
zweistellige Stückzahl für den verschwindend ge-
ringen Streubesitz effektiv gedruckt, R 9) UNC-
EF. #11. (13)
Dekorativ, große Vignette mit Sarotti-Mohr. Lochent-
wertet.
In der Berliner Mohrenstrasse (was später zur Erfindung des berühmten
“Sarotti-Mohrs” inspiriert, eines der bekanntesten Warenzeichen der Mar-
kenartikelgeschichte) eröffnet Hugo Hoffmann 1868 einen Handwerksbe-
trieb mit 10 Beschäftigten für die Herstellung feiner Pralinen, Fondants
und Fruchtpasten. 1872 erwirbt er zusätzlich die Confiseur-Waaren-Hand-
lung Felix & Sarotti in der Friedrichstrasse. 1883 tritt Paul Tiede als Teil-
haber ein, 1889 beschäftigen das Fabrikations- und das Verkaufsgeschäft
bereits 90 Mitarbeiter, deren Zahl rapide auf über 1.000 gestiegen ist, als
das Unternehmen 1903 in einen Fabrikneubau in der Belle-Alliance-Stras-
se 83 umzieht und in die “SAROTTI Chocoladen- & Cacao-Industrie AG”
umgewandelt wird. Als der Betrieb 1913 in die neu gebaute Fabrik in Tem-
pelhof verlegt wird, liegt die Zahl der Beschäftigten bereits über 2.000. Im
Jahr 1918 wird der “SAROTTI-Mohr” gestaltet und in der Werbung ver-
wendet. 1929 entsteht die Verbindung zum Schweizer Nestlé-Konzern,
dessen Marken zusätzlich in Lizenz gefertigt werden, nachdem Sarotti im
Wege einer Sachkapitalerhöhung die Hattersheimer Schokoladenfabrik
der Deutsche AG für Nestlé-Erzeugnisse übernommen hat. 1945 Demon-
tage des Tempelhofer Werkes durch die Besatzungmächte, 1949 Verle-
gung des Firmensitzes nach Hattersheim (Main). 1962 bei Einweihung des
großen Auslieferungslagers in Gladbeck/Westf. hat Sarotti über 4.000 Be-
schäftigte. 1964/65 Bau einer neuen Fabrik für Schokoladenmassen und
Tafelware in Hattersheim, in Folge dessen spezialisiert sich das Tempel-
hofer Werk 1969 auf Pralinen. Bis 1970 börsennotiert, danach 1971 Über-
tragung des operativen Geschäfts auf den Großaktionär Deutsche NEST-
LÉ GmbH und Umfirmierung in “SAROTTI Vermögensverwaltungs-AG”.
N
Los 2085
Ausruf 80 €
Sauerstoffwerk Westfalen AG
Münster i.W., Aktie 100 DM Juli 1967 (Muster, R
10) UNC-EF. (13)
Von der Stückelung 100 DM wurden nur 20 Aktien
ausgegeben. Kupons 21-30.
Gründung am 11.10.1923 unter der Firma “Sauerstoffwerke AG”. 1925
Aufnahme des Handels in Autokraftstoffen und Autoölen. Am 18.6.1925
Firmenänderung in Sauerstoffwerk Münster AG, am 29.7.1938 umbenannt
in Sauerstoffwerk Westfalen AG, 1988 in Westfalen AG. Die Aktivitäten der
Westfalen AG sind in die Geschäftsbereiche Technische Gase, Westfalen-
gas (Flüssiggas-Marke des Konzern) und Tankstellen gegliedert.
Los 2086
Ausruf 80 €
Sauerstoffwerk Westfalen AG
Münster i.W., VZ-Aktie 1.000 DM Juli 1974 (Mu-
ster, R 10) UNC-EF. (13)
Kupons 26-30.
N
Los 2087
Ausruf 180 €
Schering AG (18 Stücke)
Berlin-West, Aktien von 1955 bis 1983 UNC-EF. (13)
Aktien 100 DM (blanco) + 1.000 DM #22113 Nov.
1955; 1.000 DM (blanco) Juni 1957; 100 DM #151489
+ 1.000 DM #47131 Febr. 1958; 100 DM #30456 Jan.
1961; 100 DM #160643 Jan. 1966; 2.500 DM (blan-
co) Juni 1967; 2.500 DM #311751-800 Nov. 1967;
100 DM #242794 Jan. 1969; 50 DM (blanco) Juli
1969; 2.500 DM (blanco) Jan. 1970; 2.500 DM (blan-
co) Jan. 1972; 50 DM #745180 Jan. 1973; 2.500 DM
(blanco) Juni 1973; 50 DM (blanco) + 2.500 DM (blan-
co) Jan. 1976; 2.500 DM (blanco) Aug. 1983.
Hervorgegangen aus der 1851 von Ernst Schering eröffneten “Grünen A-
potheke” in der Chausseestraße in Berlin. 1864 gliederte Schering eine
Fabrik für reine Jod- und Bromverbindungen an. 1871 Umwandlung in die
“Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering)”. In den 20er Jahren ex-
pandierte Schering besonders in den Bereich Photopapiere und Photo-
chemikalien und übernahm 1927 in diesem Zusammenhang mit der Vo-
igtländer & Sohn AG in Braunschweig die älteste deutsche Kamerafabrik.
Ebenfalls 1927 Fusion mit der C.A.F. Kahlbaum Chem. Fabrik GmbH in
Berlin zur Schering-Kahlbaum AG. 1937 Fusion mit der (Oberschlesische)
Kokswerke & Chemische Fabriken AG (gegr. 1890), die fast 100 % der
Schering-Aktien hielt, zur “neuen” Schering AG. 1967 Errichtung eines
zweiten Sitzes in Bergkamen (Westf.). Bis zur Verschmelzung mit der Bay-
er AG Ende 2006 wurde das Unternehmen im DAX notiert. Einer der be-
deutendsten Hersteller von pharmazeutischen Spezialitäten und Substan-
zen (am bekanntesten wurde “Die Pille”), Pflanzenschutz- und Schäd-
lingsbekämpfungsmitteln, Industriechemikalien uvm. Werke in Berlin-
Wedding, Bergkamen und Wolfenbüttel.
N
Los 2088
Ausruf 125 €
Schiess AG
Düsseldorf, Aktie 1.000 x 50 DM Okt. 1970 (Mu-
ster, R 10) UNC-EF. (13)
Kupons 28-30.
Der Magdeburger Ernst Schiess (1840-1915) machte eine Karriere, wie sie
nur in der Gründerzeit möglich war: Nach Besuch der Technischen Hoch-
schulen in Hannover, Karlsruhe und Zürich durchlief er Wanderjahre in
Deutschland, Belgien und England. Als Lehrling in Manchester erkannte
er, daß die Werkzeugmaschine als “Mutter aller Maschinen” eine Schlüs-
selposition bei der Industrialisierung einnehmen wird - dafür wollte er ei-
ne Fabrik bauen. Der Schwerindustrielle Ernst Poensgen erkannte das Ta-
lent von Schiess und überzeugte ihn davon, sich in Düsseldorf anzusie-
deln. So entstand 1866 mit der “Ernst Schiess Werkzeugmaschinenfabrik
und Eisengießerei” die älteste Werkzeugmaschinenfabrik Deutschlands.
1891 betrieb Schiess die Gründung der “Vereinigung deutscher Werk-
zeugmaschinenfabriken” VDM, deren Gründungsvorsitzender er wurde.
1906 wandelte Schiess sein Unternehmen in eine AG um, Mitbegründer
war sein Schwiegersohn, der Essener Bankier Aug. von Waldthausen.
1925 Fusion mit der vormaligen Defrieswerke AG in Düsseldorf-Heerdt zur
Schiess-Defries AG (ab 1939 wieder Schiess AG). Von 1945-48 Demonta-
ge aller fünf Werke. Der Wiederaufbau erfolgte auf einem wesentlich grö-
ßeren Gelände im Stadtteil Lörick. In den 1950er Jahren Gründung von
Zweigwerken in New York und Pittsburgh sowie in Stamford (GB). 1993
vom Bremer Vulkan übernommen und in Dörries Scharmann AG umfir-
miert, 1996 dann mit dem Bremer Vulkan untergegangen. Als Nachfolge-
gesellschaft wurde mit rd. 700 Mitarbeitern in Mönchengladbach die Dör-
ries Scharmann Technologie GmbH gegründet.
216
















